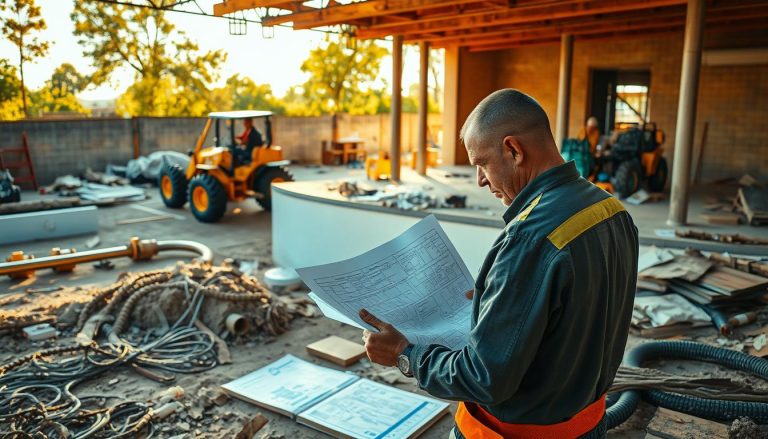Balkonkraftwerk 2025/2026 – das musst du rechtlich beachten
Balkonkraftwerke – oft auch Steckersolargeräte oder Plug-in-PV genannt – sind in Deutschland endgültig im Mainstream angekommen. Seit dem Solarpaket I (2024) wurden viele Hürden abgebaut, und diese Regeln gelten auch 2025 fort und prägen voraussichtlich ebenfalls den Alltag in 2026.
Damit du dein Balkonkraftwerk rechtssicher betreiben kannst, schauen wir uns die wichtigsten Punkte Schritt für Schritt an – inklusive der aktuellen Leistungsgrenzen, Meldepflichten, Miet- und Eigentumsrecht sowie einem Ausblick auf 2026.
Wichtiger Hinweis: Der Artikel ersetzt keine individuelle Rechtsberatung, gibt dir aber einen sehr guten Überblick über den aktuellen Stand (Herbst/Winter 2025).
1. Was ist ein Balkonkraftwerk rechtlich überhaupt?
Rechtlich wird ein Balkonkraftwerk heute als „Steckersolargerät“ eingeordnet. Es handelt sich dabei um eine Photovoltaik-Anlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), also keine „Spielerei“, sondern eine echte EEG-Anlage – nur sehr klein.
Typisch ist:
- 1–4 PV-Module am Balkon, an der Fassade oder auf der Terrasse
- ein wechselrichter Balkonkraftwerk, der den Strom direkt in dein Wohnungsnetz einspeist
- Anschluss über eine spezielle Einspeisesteckdose oder (je nach Norm & Netzbetreiber) eine Schuko-Steckdose
Durch das Solarpaket I wurden Steckersolargeräte erstmals ausdrücklich im Gesetz erwähnt und mit eigenen Regeln versehen.
2. Leistungsgrenzen 2025/2026: Wie stark darf dein Balkonkraftwerk sein?
Die zentrale Frage: Wie viel Leistung ist erlaubt?
Aktuell gelten in Deutschland für Steckersolargeräte im Regelfall:
- Max. 800 Watt (VA) Ausgangsleistung am Wechselrichter
- Max. 2.000 Watt Peak (Wp) Modulleistung für die angeschlossenen Solarmodule
Das bedeutet:
- Du darfst z. B. zwei 800–900-Wp-Module (insgesamt bis 2.000 Wp) verwenden,
- der Wechselrichter darf jedoch max. 800 W/VA in dein Netz einspeisen.
Diese 800-W-Grenze ist seit Mai 2024 gesetzlich festgeschrieben (§ 8 Abs. 5a EEG) und gilt auch 2025 fort.
Für 2026 ist Stand jetzt keine Verschärfung geplant; eher ist im Rahmen eines möglichen Solarpakets II von weiteren Vereinfachungen auszugehen, die Details stehen aber noch nicht fest.
3. Melde- und Registrierungspflichten: Marktstammdatenregister & Netzbetreiber
3.1. Registrierung im Marktstammdatenregister
Jedes Balkonkraftwerk ist eine EEG-Anlage – und muss daher im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur registriert werden.
Seit 2024 wurde das Verfahren deutlich vereinfacht:
- Nur noch eine Registrierung im MaStR,
- keine separate Anmeldung beim Netzbetreiber mehr nötig – diese Pflicht hat das Solarpaket I gestrichen.
Die Registrierung ist:
- kostenlos
- online möglich
- innerhalb von einem Monat nach Inbetriebnahme vorzunehmen (Faustregel, bitte im Einzelfall prüfen)
3.2. Muss ich den Netzbetreiber trotzdem informieren?
In vielen Regionen übernimmt das MaStR faktisch die Informationsfunktion. Einige Netzbetreiber bitten trotzdem um Mitteilung oder stellen Online-Formulare bereit. Rechtlich entscheidend ist aber die MaStR-Registrierung – die frühere Pflicht zur direkten Anmeldung entfällt für Steckersolargeräte.
4. Stromzähler, Ferraris-Messwerk und Rückwärtslaufen
Früher war die größte Hürde: „Mein alter Zähler darf nicht rückwärtslaufen!“ – das ist inzwischen entschärft.
Mit Solarpaket I gilt:
- Rückwärtslaufende Ferraris-Zähler werden übergangsweise geduldet, bis dein Netzbetreiber den Zähler austauscht. Du darfst das Balkonkraftwerk also bereits in Betrieb nehmen, auch wenn der Zähler noch nicht gewechselt wurde.
- Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dir einen passenden, nicht rückwärtslaufenden Zähler (in der Praxis meist einen modernen digitalen Zähler) zu installieren.
Die Kosten für den Messstellenbetrieb (Zähler) können leicht steigen (z. B. bis ~20 € pro Jahr mehr), sind aber in der Regel überschaubar.
Für 2025/2026 gilt damit:
- Du musst nicht warten, bis der Zähler getauscht ist.
- Das Rückwärtslaufen ist zeitlich befristet gesetzlich erlaubt (die maßgebliche Regelung im EEG ist bis Ende 2032 verlängert).
5. Anschluss: Schuko oder Wieland? Was ist erlaubt?
Normen und Empfehlungen sorgen manchmal für Verwirrung.
- Rechtlich zulässig ist der Anschluss von Steckersolargeräten an eine geeignete Steckvorrichtung, konkretisiert durch VDE-Normen.
- Verbraucherzentralen weisen darauf hin, dass bis 800 W Wechselrichterleistung vielfach der Anschluss über Schuko zunehmend akzeptiert wird, über 800 W bzw. ab 800 W Modulleistung können Netzbetreiber oder Normen einen spezialisierten Einspeisestecker (z. B. Wieland) verlangen.
Wichtig ist:
- Halte dich an die Montage- und Anschlussvorgaben des Herstellers,
- beachte ggf. Vorgaben deines Netzbetreibers,
- lass im Zweifel eine Elektrofachkraft prüfen, ob dein Hausnetz (Stromkreis, Absicherung, Leitungen) geeignet ist.
6. Mietrecht 2025/2026: Was dürfen Mieter, was der Vermieter?
Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan:
Mit Gesetzesänderungen 2024 wurden Mieterrechte und WEG-Recht zugunsten von Balkonkraftwerken gestärkt.
6.1. Grundsatz: Anspruch auf Zustimmung
- Mieter*innen haben nach dem neuen § 554 BGB einen Anspruch darauf, dass der Vermieter bestimmte Modernisierungsmaßnahmen (hier: Installation eines Balkonkraftwerks) zustimmt, wenn berechtigte Interessen vorliegen und die Maßnahme zumutbar ist.
- Balkonkraftwerke werden rechtlich als Maßnahme zur Nutzung erneuerbarer Energien betrachtet.
Ein Vermieter darf also nicht mehr pauschal „Nein“ sagen, sondern muss sachlich begründen, warum die Maßnahme unzumutbar sein soll – z. B. bei:
- erheblichen Eingriffen in die Bausubstanz,
- statistischen Problemen (zu schwere Anlage am Geländer),
- gravierenden optischen Beeinträchtigungen bei erhaltenswerten Fassaden,
- Konflikten mit Denkmalschutz.
6.2. Form der Zustimmung
Trotz der Stärkung der Mieterrechte gilt:
- Du solltest immer vorher schriftlich um Zustimmung bitten.
- Am besten mit:
- technischem Datenblatt (Gewicht, Maße, Leistung),
- Montageplan (kein Bohren in Fassade, nur Geländerhaken etc.),
- Hinweis auf Rückbaubarkeit beim Auszug.
So senkst du das Konfliktpotenzial und zeigst, dass du dich an Recht und Sicherheit hältst.
7. Wohnungseigentumsrecht (WEG): Was gilt in der Eigentümergemeinschaft?
Auch im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) wurden die Rechte für Balkonkraftwerke 2024 verbessert.
Wichtige Punkte:
- Balkonkraftwerke zählen zu Maßnahmen, die der nachhaltigen Energieversorgung dienen.
- Eigentümer*innen haben einen Anspruch auf Gestattung, wenn die Maßnahme zumutbar ist und keine unbillige Beeinträchtigung der übrigen Eigentümer darstellt.
- Oft muss die Anbringung in der Eigentümerversammlung beschlossen werden – insbesondere, wenn das äußere Erscheinungsbild der Anlage betroffen ist.
Empfehlung:
- Frühzeitig Antrag an die WEG-Verwaltung stellen,
- konkrete Pläne vorlegen (Fotos/Skizzen),
- ggf. Bereitschaft signalisieren, auf ein gemeinsames Gestaltungskonzept der WEG einzugehen (z. B. einheitliche Modulpositionen).
8. Bau- und Sicherheitsrecht: Montage, Standsicherheit, Brandschutz
Auch wenn Balkonkraftwerke „klein“ sind, gelten grundlegende Sicherheitsanforderungen:
- Standsicherheit & Windlast
- Das Geländer muss die zusätzliche Last aushalten.
- Die Befestigung muss sturmsicher sein, damit bei Sturm keine Module herabstürzen.
- Brandschutz & Elektro-Sicherheit
- Nur zertifizierte Komponenten (Wechselrichter mit Netz- und Anlagenschutz, CE-Kennzeichnung etc.) verwenden.
- VDE-konforme Installation, kein „Basteln“ an 230-V-Leitungen.
- Kommunale Vorschriften & Denkmalschutz
- In einigen Städten oder bei denkmalgeschützten Gebäuden können zusätzliche Vorgaben gelten (z. B. keine Frontmontage zur Straße).
- Im Zweifel bei Bauamt oder Denkmalschutzbehörde nachfragen.
9. Versicherung & Haftung
Wer haftet, wenn etwas passiert?
- Privathaftpflicht: Prüfe deine Police – viele Versicherer schließen Balkonkraftwerke inzwischen ausdrücklich ein oder bieten entsprechende Erweiterungen an.
- Hausrat-/Wohngebäudeversicherung: Klären, ob Schäden am Modul (z. B. Sturm, Hagel, Vandalismus) abgedeckt sind und ob das Balkonkraftwerk als fest verbauter Gebäudebestandteil gilt.
Grundsatz:
- Wenn du grob fahrlässig installierst (z. B. unsichere Befestigung, nicht zugelassene Elektrik), kannst du im Schadenfall persönlich haften.
- Saubere Montage nach Herstellervorgaben + ggf. Fachprüfung minimiert das Risiko erheblich
10. Steuerliche Behandlung & Mehrwertsteuer
10.1. Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
Seit Anfang 2023 gilt für kleine PV-Anlagen (inkl. Balkonkraftwerke) der 0 % Umsatzsteuersatz für Kauf & Installation, sofern bestimmte Leistungsgrenzen eingehalten werden (bis 100 kW), und diese Regelung wurde mit Solarpaket I bis Ende 2032 verlängert.
Für dich bedeutet das:
- Du bezahlst beim Kauf in der Regel keine Mehrwertsteuer (0 %-Rechnung),
- es ist keine komplizierte Umsatzsteuerpflicht als Unternehmer notwendig, solange du im typischen Balkonkraftwerk-Rahmen bleibst.
10.2. Einkommensteuer
Klein-PV-Anlagen für Wohnzwecke (häusliche Nutzung) sind häufig nach § 3 Nr. 72 EStG von der Einkommensteuer befreit. Das betrifft vor allem Fälle, in denen du Strom in das öffentliche Netz einspeist und Einspeisevergütung erhältst; bei Balkonkraftwerken steht meist der Eigenverbrauch im Vordergrund.
11. Was ändert sich voraussichtlich bis 2026?
Stand Ende 2025 zeichnen sich folgende Entwicklungen ab:
- Solarpaket II (geplant)
- Ziel: weitere Vereinfachungen im PV-Bereich.
- Konkrete Inhalte für Balkonkraftwerke sind noch in Diskussion, aber eher Erleichterungen als Verschärfungen.
- Produktnorm & VDE-Regelwerk
- Eine spezifische Produktnorm für Steckersolargeräte ist in Vorbereitung; ein Entwurf liegt bereits vor und regelt u. a. Sicherheitsanforderungen und Stecksysteme.
- Die Tendenz geht zu mehr Klarheit in Bezug auf Schuko/Wieland, Laieninstallation & Schutzmechanismen.
- Miet- und WEG-Recht
- Die 2024 in Kraft getretenen Erleichterungen bleiben maßgeblich – Mieter und Wohnungseigentümer behalten ihre erweiterten Rechte.